Die 5G-Frequenzauktion ist zu Ende. Alle vier mitbietenden Mobilfunkbetreiber konnten 5G-Frequenzen ersteigern: Telekom, Vodafone, O2/Telefónica und der bislang nur als Wiederverkäufer aktive Newcomer 1&1 Drillisch. Doch die Auktionserlöse beziehungsweise die zu bezahlenden Frequenznutzungsgebühren sind mit insgesamt 6,6 Milliarden Euro höher als in der Branche erhofft. Und auch sonst wird bereits intensiv über das weitere Vorgehen diskutiert und auch gestritten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, die sich zur Zukunft von 5G nun stellen.
Frage 1: Was war im Detail das Ergebnis der 5G-Frequenzauktion 2019?
Alle vier bietenden Unternehmen haben den Zuschlag für 5G-Frequenzblocks bekommen. Laut Beobachtern hat vor allem das Hinzukommen des neuen Anbieters 1&1 Drillisch – beziehungsweise der zeitweise Versuch der drei alteingesessenen Anbieter, ihn aus der Auktion herauszudrängen – zu dem unerwartet hohen Ergebnis geführt.
Telekom und Vodafone haben im für 5G besonders relevanten Frequenzbereich um 3,6 GHz jeweils Spektrum in einer Bandbreite von 90 Megahertz ersteigert. Das Auktionsverfahren hat zur Folge, dass die Teilnehmer dafür unterschiedliche Beträge bezahlen müssen: Die Telekom bezahlt 1,32 Milliarden Euro, Vodafone 1,07 Milliarden. Telefónica/O2 bekommt 70 Megahertz, muss dafür aber kaum weniger bezahlen als Vodafone – 1,04 Milliarden Euro. 1&1 Drillisch geht mit 50 MHz Spektrum für 0,74 Milliarden Euro aus der Auktion.
Zusätzlich haben alle vier Anbieter auch Spektrum im 2-GHz-Band ersteigert: Die Telekom 4x 10 MHz für 852 Millionen Euro, Vodafone ebenfalls 4x 10 MHz für 807 Millionen, Telefónica/O2 2x 10 MHz für 381 Millionen und 1&1 Drillisch ebenfalls 2x 10 MHz für 335 Millionen.s
Frage 2: Sind rund 6,6 Milliarden Auktionserlös für die 5G-Frequenzen zu hoch oder gehen sie in Ordnung?
Die Antwort auf diese Frage hängt sicherlich davon ab, wem man sie stellt. Die Netzbetreiber werden nicht müde zu betonen, dass jeder Euro, den sie für Frequenzen ausgeben müssen, beim eigentlichen Netzausbau fehlen wird. Bundesfinanzminister Scholz und der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer freuen sich hingegen über den hohen Erlös, der klar über den Erwartungen liegt. Im Vorfeld hatten Regierungsvertreter geäußert, man rechne allenfalls mit 4 bis 5 Milliarden Auktionserlös.
Die vorherige Mobilfunkfrequenzauktion im Jahr 2014, die noch für 4G- und GSM-Frequenzen durchgeführt worden war, hatte 5,1 Milliarden Euro eingebracht. Alle diese Beträge sind aber vergleichsweise gering, wenn man sie mit den über 50 Milliarden Euro (bzw. 100 Milliarden D-Mark) vergleich, die im Jahr 2000 für die UMTS-Frequenzen (3G) erzielt wurden. Allerdings haben seither alle Beteiligten – sowohl Netzbetreiber als auch die Regierung und Beobachter des Mobilfunkmarkts – eingeräumt, dass dieses Auktionsergebnis seinerzeit viel zu hoch war. Es gilt als Hauptgrund dafür, dass deutsche Kunden noch heute deutlich höhere Mobilfunkgebühren bezahlen als in vielen europäischen Nachbarländern.
Frage 3: Wie soll das eingenommene Geld verwendet werden?
Bereits im Vorfeld und während der Auktion hatten die Bundesnetzagentur und das zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angekündigt, dass die Frequenzerlöse direkt dem Breitbandausbau in Deutschland zu Gute kommen soll. Rund 30 Prozent des eingenommenen Betrags, also knapp 2 Milliarden Euro, sollen in die Verbesserung der IT-Ausstattung und Internet-Anbindung von Schulen fließen.
Die restlichen 70 Prozent beziehungsweise rund 4,5 Milliarden in die Förderung des bundesweiten Breitbandausbaus. Vor allem letzter Betrag weckt aber bereits große Begehrlichkeiten: So fordert der Bundesverband Breitbandkommunikation BREKO, das Geld vor allem in den Glasfaser-Ausbau zu investieren – schließlich brauche auch 5G eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur. Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter schlägt vor, das Geld an die Netzbetreiber zurückzugeben – mit der Auflage, es gezielt für den Aufbau von 5G-Infrastruktur auszugeben. Und ländliche Kommunen führen an, dass vor allem auf dem flachen Land ein großes Defizit bei der Internetversorgung herrscht, und die Gelder deshalb vor allem dort investiert werden sollen.
Bei alledem sollte man aber auch nicht vergessen, dass auch schon vor der 5G-Frequenzauktion Fördertöpfe für den regionalen Breitbandausbau bereitstanden, die schon seinerzeit gar nicht vollständig von den Kommunen abgerufen wurden. Dies hat aber wiederum auch mit dem von vielen Experten als zu kompliziert und schwerfällig kritisierten Zulassungs- und Baurecht zu tun.
Frage 4: Wann kommt nun 5G in Deutschland? Und reicht es dann bis zur berühmten Milchkanne?
Vor allem im Bereich von Installationen für Industriekunden als auch bei lokalen Pilotprojekten nehmen die Anbieter nun erste 5G-Installationen in Betrieb. Für sie sind die ersteigerten Frequenzen aber noch gar nicht relevant – sie dürfen erst ab 2021 genutzt werden. Dieses Jahr dürfte deshalb einen breiteren Start von 5G erleben.
Allerdings: Für die in den Auktionsbedingungen formulierten Versorgungverpflichtungen (98 Prozent der Haushalte, alle Bundesautobahnen sowie die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege mit mindestens 100 Mbit/s anzubinden sowie die meisten anderen Verkehrswege inklusive Wasserstraßen mit mindestens 50 Mbit/s) werden die Netzbetreiber in erster Linie auf 4G/LTE setzen. Denn wie schon im Vorfeld der Auktion von vielen Experten angeführt wurde, eignet der 3,6-MHz-Bereich für großflächige Mobilfunkversorgung eher schlecht. Eigentlich ist das aber eine gute Nachricht, denn von besserem LTE-Ausbau haben die Kunden in der Fläche zunächst deutlich mehr als von 5G. Das gilt nicht zuletzt auch für die zum Symbol dieser Mobilfunkversorgungs-Diskussion gewordene Milchkanne.

Echtes 5G wird in Ballungszentren starten. Dabei ist abzusehen, dass die Anbieter nicht zuletzt auch auf „Fixed Mobile Access“ setzen werden – also die Bereitstellung von heimischen Breitbandzugängen per 5G als Alternative zu DSL, Glasfaser und Breitbandkabel.
Frage 5: Lohnt es sich, schon jetzt ein 5G-Smartphone zu kaufen?
Viele Anbieter haben die ersten Generationen von 5G-Smartphones bereits vorgestellt. Darunter die aus mechanischen beziehungsweise politischen Gründen nicht unproblematischen „Foldables“ von Samsung und Huawei. In der Praxis werden Kunden am Anfang von 5G-Smartphones keine größeren Vorteile haben. Weil die 5G-Modem- und Chiptechnik erst am Anfang steht, dürfte die erste 5G-Smartphone-Generation sogar deutlich mehr Strom verbrauchen und damit kürzere Laufzeiten erreichen als die heute schon sehr ausgereiften 4G/LTE-Smartphones.

Wer nicht aus Prinzip als „Early Adopter“ mit einem 5G-tauglichen Smartphone herumlaufen möchte, ist also gut beraten, noch ein, zwei Gerätegenerationen abzuwarten, bevor er beim Smartphone von 4G auf 5G umsteigt. Etwas anders kann es bei mobilen WiFi-Hotspots aussehen – sie spielen die 5G-Vorteile wie höhere Datenraten und kürzere Latenzen möglicherweise deutlicher aus als klassische Smartphones.
Frage 6: Was steckt hinter dem Frequenzbereich, der exklusiv für Industriekunden bereitgestellt wird?
Industrieunternehmen setzen auf 5G, um sogenannte Campusnetze zu betreiben. Damit sollen in Zukunft zum Beispiel Produktionsroboter gesteuert oder Sensoren in Industrie-4.0-Anwendungen vernetzt werden. Um dies zu ermöglichen, hat die Bundesnetzagentur für solche Industrieanwender einen eigenen Frequenzbereich mit der vergleichsweise üppigen Bandbreite von 100 Megahertz freigehalten. Da die Unternehmen diese Frequenzen nur an ihren jeweiligen Standorten benötigen, können sie sie für lokal begrenzte Bereiche für eine noch nicht bekannte Gebühr erwerben.
Den Netzbetreibern ist diese Regelung ein Dorn im Auge. Zum einen, weil sie das reservierte Spektrum lieber für ihre öffentlichen Netze nutzen würden. Zum anderen, weil Industriekunden eine wichtige Zielgruppe für erste 5G-Installationen sind. Viele Unternehmen denken jedoch darüber nach, die notwendigen Campus-Netze selbst aufzubauen und in Eigenregie zu betreiben. Damit könnte den Netzbetreibern dieses für sie attraktive Geschäft zu einem großen Teil verloren gehen.
Allerdings stellen Unternehmen nun auch zunehmend fest, dass der Betrieb eigener Funknetze, auch auf engstem Raum, alles andere als trivial ist. Daher ist nicht unwahrscheinlich, dass große Industriekunden und die 5G-Netzbetreiber letztlich doch noch zusammenkommen dürften.
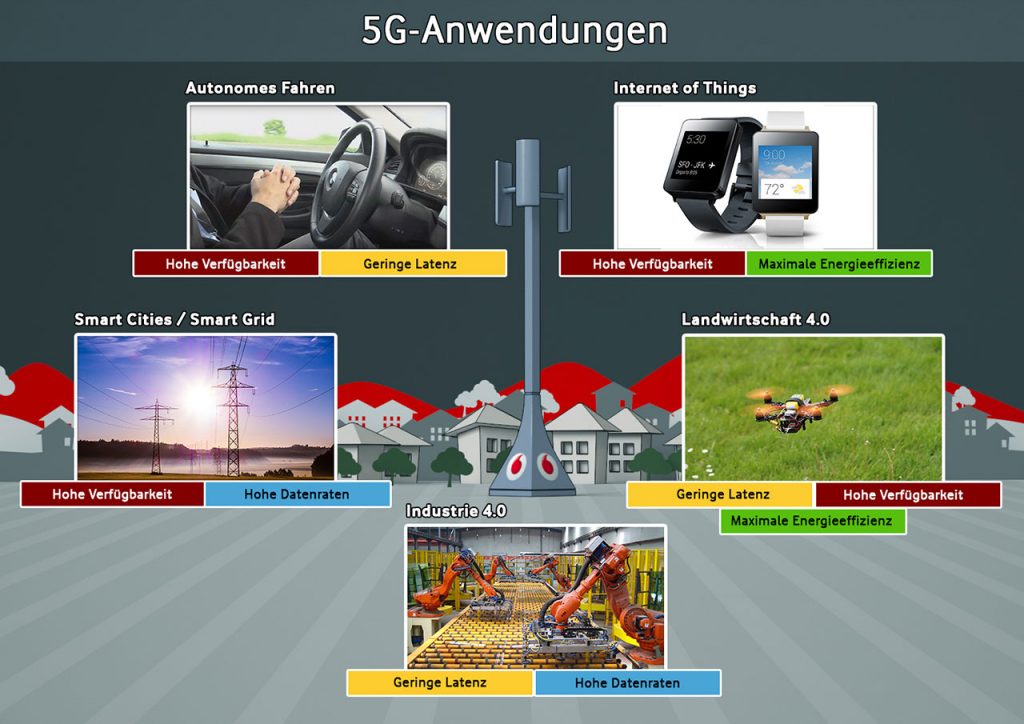
Frage 7: Wie ist die Diskussion um die Strahlenbelastung von 5G einzuschätzen?
Die grundsätzliche Funktionsweise von 5G unterscheidet sich auf der Funkstrecke kaum von den früheren Mobilfunkstandards. Solange die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, gehen Wissenschaft und Behörden deshalb davon aus, dass 5G keine zusätzlichen Risiken gegenüber 4G und früheren Mobilfunktechnologien darstellt.
Mobilfunkgegner und Strahlungskritiker haben bei jeder Einführung einer neuen Mobilfunktechnik deren grundsätzliche Unbedenklichkeit in Frage gestellt. Das lässt sich auch damit erklären, dass das Thema in solchen Phasen eine höhere Aufmerksamkeit in den Medien und in der öffentlichen Diskussion erfährt.
Wird angeführt, dass sich bei 5G wegen neuer Frequenzbereiche neue Fragen stellen, so gilt dies kaum für die bislang versteigerten Frequenzen – 3,6 GHz liegt nicht so viel höher als die bislang genutzten Mobilfunkfrequenzen etwa bei 2,6 GHz. Eine Neubewertung wird erst bei den sogenannten Millimeterwellen nötig werden, die bei 26 GHz und höher liegen. Deren Versteigerung liegt aber noch in der Zukunft.
Dass bei 5G vor allem in städtischen Bereichen mehr Basisstationen eingesetzt werden als bei früheren Funkstandards, sorgt nicht per se zu einer höheren elektromagnetischen Belastung. Denn mehr Basisstationen können mit geringerer Sendeleistung arbeiten. Das kann sogar zu einer Verringerung der Gesamtexposition führen.
Ein anderer Aspekt ist die bei 5G eingesetzt Massive-MIMO-Technik: Bei der Übertragung von Funksignalen sind Reflektionen mit eingeplant, zudem fokussieren 5G-Antennen beim Senden die Funkenergie auf den Empfänger. So werden die Signale über mehrere Wege übertragen. Beim Empfänger beziehungsweise seinem Endgerät konzentrieren sie sich. Auch dabei müssen die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Es ist aber sicher sinnvoll, diese Effekte gezielt zu erforschen – was Wissenschaft auch fordern.

